In diesem neuen Kapitel widmen wir uns weiter dem Weg eines Artefakts in unserem Museum.
Indem es in die Sammlung gekommen ist, wurde es abgetrennt vom performativen Kontext sowie von seiner Herkunftsgesellschaft; eventuell steht es sogar ganz allein noch als Zeugnis für eine durch Kolonialisierung und Christianisierung ausradierte kulturelle Praxis.
Als Mitglied in der Sammlung eines Museums werden die definierten Museumszwecke des Sammelns, Bewahrens, Forschens und Zeigens bzw. Vermittelns zu den neuen Aufgaben dieses Artefakts: an ihm erfüllt sich der Museumsauftrag. Dieser Übergang – diese Transition – besitzt eine große Ambivalenz. Im Museum wird gesammelt und aufbewahrt; es ist per definitionem ein von gewissen allgemeingültigen Zwängen freier Raum: hier gilt weder der Effizienzgedanke noch wird grundsätzlich in ökonomischen Kategorien gedacht. Es ist einer der seltenen noch verbliebenen Freiräume unserer Welt. Ein Museum bewahrt aber nicht nur Gegenstände auf, es ist auch der Ort, all das Weltwissen über diese zentral zu bündeln und dauerhaft zu sichern. Zugleich beinhaltet die Aufgabe des Museums auch die Präsentation der Objekte, ihr Zugänglichmachen für die Öffentlichkeit. In einer Museumssammlung kann ein Objekt auch die ungewöhnlichsten Begegnungen erleben, die in der Realität seines kulturellen Kontextes niemals möglich gewesen wären: in einem Depot wird die Lautréamontsche Begegnung der Nähmaschine mit dem Regenschirm auf dem Seziertisch zum Normalfall.

Krysztof Pomian hat den Übergang von Objekten in eine Museumssammlung mit dem Begriff Semiophor beschrieben
Semiophoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren (Desemiotisierung) und eine neue – im Museumskontext – bekommen (Resemiotisierung). Einerseits lässt sich dies als (Kontext-)Verschiebung beschreiben. Andererseits lässt sich insbesondere an seltenen und besonders wenig erforschten Objekten gleichsam eine Verdichtung bemerken: sie werden zum Zeugnis einer „untergegangenen“ Zivilisation, einer seltenen Kulturtechnik o.ä., die sich in ihnen allein noch zu manifestieren scheint. Dadurch wird ihnen eine Bedeutsamkeit zugeschrieben, die nichts mit ihnen selbst zu tun hat, sondern allein mit dem Prozess ihrer Ablösung aus dem Ursprungskontext und den daraus resultierenden Wissenslücken. Alltagsgegenständen, Gebrauchsobjekten, die ursprünglich nur eine geringe Lebensdauer hatten, wird im Rahmen einer Museumssammlung gleichsam ewiges Leben verliehen.
Bei all diesen theoretischen Überlegungen wird die Institution Museum idealisiert und verdeckt dadurch das Moment der Gewalt, das am Beginn allen Sammelns steht.
Der Preis für das „ewige Leben“ im Museum ist der Verlust, die Lücke, die das Objekt an seinem Herkunftsort hinterlässt. Insbesondere bei Konvoluten, die aus einem kolonialen Kontext stammen, muss dieses Gewaltmoment thematisiert werden. Die Ermächtigung der Institution Museum, allein über ihre Sammlung sprechen zu dürfen, perpetuiert die Gewalt: sie macht die Herkunftsgesellschaften sprachlos.
Im Rahmen des Museums mit seiner unbedingten Forderung nach Präsentation und Vermittlung bleibt überdies wenig Raum für die Frage, ob es Objekte gibt, die nicht gezeigt werden sollten. So gibt es z.B. einige kulturelle Praktiken, die nur von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen ausgeführt werden dürfen (beim Sogo bò in Mali z.B.). Oder Figuren werden dezidiert nicht für die Öffentlichkeit geschaffen. Ist es dann angebracht, sie in ihren Funktionsweisen im Museum komplett auszustellen und zu erklären?
Innerhalb des musealen Kontextes werden Rahmen für die Präsentation der Objekte geschaffen
Der erste Rahmen ist das Museum selbst, mit seinem Namen, seinem Thema, seiner Vision, seinem Zweck. Bei uns ist dies „Figurentheater“. Und unter diesem Blickwinkel betrachten wir eben auch Objekte, die ursprünglich vielleicht nicht oder nur zum Teil Figurentheater im westeuropäischen Sinn zugerechnet werden können. Das kann sehr produktiv sein; unsere Objekte geraten in einen Austausch, durch den neue Bedeutungen entstehen.
„Der Wunsch nach Erkenntnis aus dem Umgang mit Dingen ist eine zentrale Idee des Museums als Institution, die Wissen über die Welt vermittelt, indem sie Dinge sammelt und sie im Raum ordnet und zeigt.“
Das ist die Besonderheit jedes Museums und ein Gut, das besonders in Zeiten einer Durchdigitalisierung unseres Lebens nicht zu unterschätzen ist.
Zugleich müssen wir uns als Institution dieses Rahmens als Setzung auch immer wieder bewusst werden.
So ist die Präsentation im Rahmen einer Ausstellung eben bewusst kuratiert, sie ist eine „Anordnung von Dingen im Raum nach Maßgabe einer Deutung“ (Korff zit. nach Thiemeyer 2016: 19). Wie Thiemeyer im Folgenden ausführt, geht es um „eine Präsentation von Wissen, die Wirklichkeit nicht nur abbildet, sondern auch erzeugt, immer bestimmten Absichten folgt und politisch motiviert ist“ (ebda). Umso wichtiger ist es, sich der Ausschlussmechanismen, die hier im Herzen der Institution Museum greifen, bewusst zu werden. In die Bedeutungen, mit denen Objekte in der Anschauung im Museum aufgeladen werden, sind kolonialistische Überzeugungen eingeschrieben, davon müssen wir ausgehen. Jeder Sammelprozess ist nicht nur potenziell gewalttätig, sondern von Ziel und Zweck begleitet. Es ist ein Auswählen von Objekten, dem eine Bewertung unterliegt: was ist es wert, in einem Museum ausgestellt zu werden? Bewahrt und beforscht zu werden? So ist diese Bedeutungsaufladung der Objekte im Museumskontext zwar theoretisch betrachtet ein dem Abtrennen, d.h. dem Verlust des Ursprungskontextes entgegengesetzter Prozess. Er hat jedoch – wie das oben erwähnte „ewige Leben“ – einen Preis: Bedeutungsaufladung im Museum kann nicht neutral verlaufen noch mit der Rekonstruktion des Ursprungskontextes gleichgesetzt werden. Es ist ein Verfügen über die Dinge, die sich gleichsam als „herrenlos“ und sprachlos angeeignet werden.
Es besteht die Gefahr, dass, je stärker eine Ausstellung auf Inszenierung setzt, je stärker sie Atmosphäre schaffen will – womöglich noch „authentische“ – desto dominanter das Reden über die Objekte ist.
Die Steuerung dessen, war BesucherInnen denken und empfinden und „mitnehmen“ sollen, ist optimiert. Damit ist weder Platz für die individuelle Rezeption noch für ein Sprechen der Objekte selbst. Lücken, weiße Flecken und eine generelle Offenheit haben hier keinen Platz.

Wie haben wir in der Vergangenheit unsere Sammlungsobjekte gezeigt?
Die Einteilung unserer Museumspräsentation in geographische Räume zeugt von einer vorgelagerten Entscheidung über Tiefenschärfe: im „europäischen Teil“ begannen wir mit einzelnen Marionettenspielerfamilien (Schichtl, Winter), mit besonderen Situationen wie dem Jahrmarkt, den verschiedenen Figurenarten (Handpuppe, Marionette, Schattenfigur) und begleitenden Phänomenen wie Schaustellerei und Moritatengesang. Weitere Themenräume umfassten Thailand, Myanmar, China und Indien. Diese zeigten verschiedene Figurentheatertraditionen und -formen allein anhand der Figuren ohne weitere Vertiefung des Kontextes. Hier waren in der reinen Gegenüberstellung tatsächlich überraschende Erkenntnisse zu gewinnen. Weitaus am stärksten wurde in den Räumen generalisiert, die afrikanischen Figuren vorbehalten waren: hier hieß es schlicht „afrikanische Tradition“.
„Was aber klar wird, ist, dass die Diversität eines gesamten Kontinents auf eine Kultur – im Singular – reduziert wird. Diese Ambiguität, die die Kulturen, Sprachen und Herkünfte der sehr vielen verschiedenen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent unter einem Titel zusammenklumpt, ist exemplarisch für die (rassistische) eurozentrische Perspektive auf Afrika. Denn rassistische Strukturen verweigern es, die Unterschiede zwischen Regionen, Orten und Gruppen von Menschen, Kulturen und Sprachen anzuerkennen und auseinanderzuhalten. Diese Verleugnung von Individualismus ist die üblichste Form von Rassismus, die ich beobachtet habe.“
In den Vitrinen waren die Figuren zwar größtenteils nach Ländern gruppiert (u.a. Mali, Nigeria, Gabun), allerdings ging die Spezifik der jeweiligen Aufführungstraditionen und -kontexte unter. Mit „atmosphärischer“ Bemalung der Wände in einem pseudo-afrikanischen Stil und der effektvollen Hängung großer Objekte im Dachgestühl (die anders aufgrund der Raumsituation auch nicht hätten präsentiert werden können) wurde tatsächlich ein besonderer Raum geschaffen, in dem aber schon von der Grundanlage her nicht nur Rassismus eingeschrieben, wie von Ngubia Kuria oben erläutert, sondern vor allem eine exotistische Perspektive konstruiert wurde: diese Figuren sind etwas ganz Besonderes, aber eben auch nicht ganz zu Verstehendes, drückte dieser Raum aus. Dabei ist dieses „Nichtverstehen“, dieses apostrophierte „Mysterium“ tatsächlich etwas, das man besser auf alle Theaterfiguren unserer Sammlung anwenden könnte. Denn der Prozess der Animation und Verlebendigung, der uns fasziniert, und die Bedeutungen, die im Moment der Performance entstehen, sind tatsächlich schwer und wissenschaftlich immer nur ungenau zu beschreiben. Thematisiert wurde dieser Gedanke aber allein im Raum zu „Afrika“ (mit dem Verweis auf die angebliche „Ritualgebundenheit“ dieser Traditionen) und damit nicht dem Phänomen „animierte Objekte und Figuren“, sondern dem Kontinent und seinen BewohnerInnen zugeordnet.
Interessant ist es in diesem Zusammenhang, einen Blick auf die letzte Inszenierung der deutschen Marionettenspielerfamilie Schichtl zu werfen. Hier wurde an einer Wand ein „historisches“ Regal nachgebaut (an der gegenüberliegenden Wand befand sich das entsprechende Originalfoto). Dadurch sollten die BesucherInnen eine Ahnung davon bekommen, wie es in der fahrenden Werkstatt und Requisite der Familie Schichtl zuging. Teilweise waren in dem Regal auch unter Plexiglas Originalfiguren ausgestellt. An einem anderen Teil ging man durch einen Vorhang wie in eine Theatersituation hinein und konnte auf zwei Bänken platznehmen. Spotlights erleuchteten nacheinander verschiedene Figuren in der dunklen Bühnentiefe.
BesucherInnen sollten auch hier die Atmosphäre eines Theaterbesuchs spüren können. In diesem Kontext wurden Figuren, die rassistische Stereotypen zeigen, unkommentiert ausgestellt. Für Fragen von Kolonialismus und Rassismus war in diesem „atmosphärischen Eintauchen“ kein Platz. Dabei reflektierten die Figuren z.B. deutlich, wie die Familie Schichtl sich mit ihren Figuren und Programmen an den damals äußerst erfolgreichen Völkerschauen orientierte.
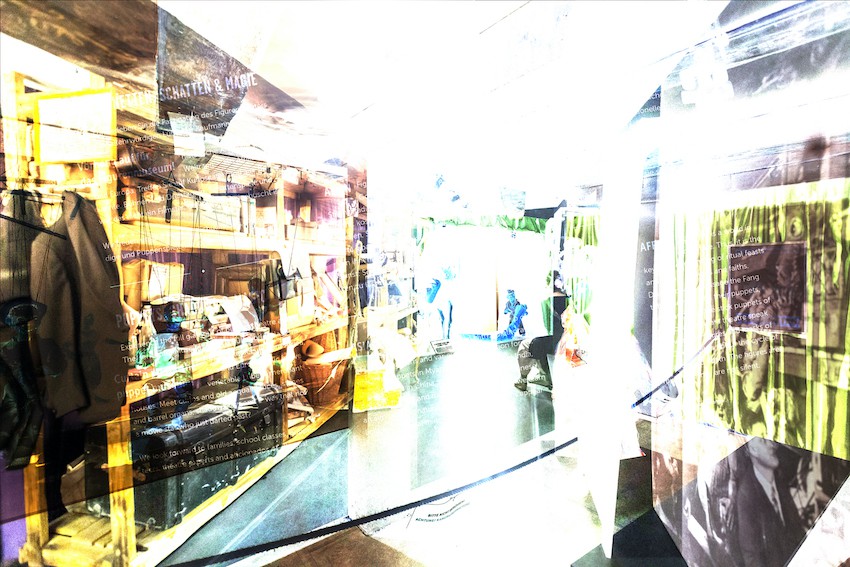
Selten vertrauen Museen ganz auf die reine Evidenz der Anschauung – wir belassen es nicht dabei, Objekte einfach für sich stehen und wirken zu lassen.
Wir möchten sie erklären. Das geschieht häufig durch ein „Reden über“ statt durch ein „Sprechen lassen“ der Objekte an sich. Oder durch das Sprechen von Menschen aus Herkunftsgesellschaften, die mit den kulturellen Praktiken noch vertraut sind oder waren. Zu deren eigener Geschichte sie gehören. Dem Objektschild haftet eine vermeintliche Neutralität und Wissenschaftlichkeit an, die dem, was dort geschrieben steht, Allgemeingültigkeit verleiht. Es gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben, diesem Sprechen der Objekte selbst und dem Sprechen über die Objekte Vielstimmigkeit zu verleihen. Dazu gehört die aktive Kontaktaufnahme zu Menschen in den Herkunftsgesellschaften. Dazu gehört die Offenheit für Stimmen der BesucherInnen, die mit ihren eigenen Erfahrungen und kulturellen Prägungen auf unsere Sammlung treffen. Dazu gehört auch die präzise Inventarisierung unserer Objekte immer unter Angabe von Quellen – woher kommt diese Information? Ist sie belegbar? Ist sie womöglich schon überholt? Und dazu gehört schließlich die Veröffentlichung unserer Bestände in einer Online-Datenbank, damit von überall auf der Welt auch einsehbar ist, was bei uns lagert. Nur so kann eine Stimmenvielfalt entstehen.
Menschen können wir nicht besitzen; zu dieser Erkenntnis sind wir schon lange gekommen, seit dem offiziellen Ende der Sklaverei. Vielleicht müssen wir auch zu einem neuen Verständnis unseren Sammlungsartefakten gegenüber kommen. Vielleicht können wir auch diese nicht besitzen. Wenn wir den Begriff von der „agency der Dinge“ wirklich auch als Institution ernst nehmen, so bedeutet es nichts anderes, als die Möglichkeit in den Blick zu nehmen, dass Dinge uns auch wieder verlassen können. Für Museen, die eigentlich ausschließlich „sub specie aeternitatis“ agieren, eine schmerzhafte Erkenntnis.
Quellen und weiterführende Literatur:
Korff, Gottfried: Museumsdinge. Deponieren – Exponieren, Böhlau, Köln / Weimar / Wien 2007
Ngubia Kuria, Emily: „‘AFRIKA!‘. Seine Verkörperung in einem deutschen Kontext“, in: Nduka-Agwu, Adibeli; Lann-Hornscheidt, Antje (Hg.): Rassismus auf gut Deutsch. Ein kritisches Nachschlagewerk zu rassistischen Sprachhandlungen, Frankfurt a.M. 2010, S. 223-237
Pomian, Krzysztof: Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln. Berlin 1988
Thiemeyer, Thomas: „Das Museums als Wissens- und Repräsentationsraum“, in: Walz, Martin (Hg.): Handbuch Museum. Geschichte. Aufgaben. Perspektiven, Stuttgart 2016, S. 18-21
